Ich war immer voreingenommen gegen Berte Bratt. Berte Bratt, die in der Stadtbücherei drei Regalbretter und im Schneiderbuch-Katalog ganze Seiten im Alleingang füllte, war für mich immer die Definition jener Art Mädchenbuch, die ich nicht las – ich mutmaßte, dass diese Geschichten von Liebe handeln mussten, und so etwas Reaktionäres und Konventionelles lehnte ich doch entschieden ab. Jugendbücher sollten über aktuelle Probleme informieren, nicht von Liebe handeln! So war Berte Bratt also mein Feindbild, ohne dass ich je ein Buch von ihr gelesen hatte, und ohne dass ich irgendjemanden gekannt hätte, der das tat. Dennoch hielt ich es für abscheulichen Mainstream. Ich schreckte nicht davor zurück, Enid Blytons gesammelte Werke zu lesen… Manchmal glaube ich, ich war ein komischer Mensch. Meistens glaube ich, ich bin es immer noch. Dennoch habe ich jetzt ein Buch von Berte Bratt gelesen. Und de fakto war das Werk nicht einmal schlecht.
Ich bin, wie so oft, durch Zufall darangekommen, als Büchereipraktikantin. Immer wieder kommt es vor, dass freundliche Menschen der Stadtbücherei Bücher spenden, und diese enden dann entweder in der Wühlkiste oder werden in den Bestand eingearbeitet. Die Spende, mit der ich es zu tun hatte, enthielt einen Berg Mädchenbücher, die gesammelten Werke Berte Bratts, und das ist nicht mehr unbedingt das, was die jungen Mädchen des neuen Jahrtausends noch gerne lesen. Vor allem nicht mit diesen authentischen Siebziger-Jahre-Titelbildern. Der Großteil dieser Bücher wird also wohl in der Wühlkiste gelandet sein. Es macht wenig Sinn, Zeit und Material und Regalplatz aufzuwenden für ein Buch, das keinen Leser mehr findet, selbst wenn es eine Spende war. Aber jene Titel, die schon im Bestand waren, durften bleiben, um die Altexemplare zu ersetzen – die dann wiederum, natürlich, in die Wühlkiste wandern sollten. Das Einarbeiten durfte ich machen, vom Folieren übers Etikettieren bis zum Katalogeintrag. Ich liebe diese Arbeit. Und ich liebe es, dabei ein bisschen und in Ruhe in den Büchern zu blättern und hineinzulesen. So erschnupperte ich dann die ersten Seiten von Meine Tochter Liz, und nachdem das Buch – von mir eingearbeitet, mir ganz allein – dann glücklich im Regal stand, musste ich es natürlich sofort und voll Stolz ausleihen. Ich war erst angetan, und dann verärgert:
Wir haben es hier nämlich mit dickem Etikettenschwindel zu tun. Nicht nur ist Meine Tochter Liz nicht die Tochter der Heldin, und sie heißt auch gar nicht Liz, sondern Lisbeth. Auch die Autorin heißt gar nicht Berte Bratt. Berte Bratt heißt – hieß, denn sie starb 1990 – Annik Saxegaard. Und unter diesem Namen veröffentlichte sie auch ihre Bücher, nur für den deutschen Markt drückte der Schneider-Verlag der Norwegerin dieses zungenfreundliche Pseudonym auf. Zu guter Letzt ist die Heldin des Buches, Steffi, nicht, wie der Klappentext uns weismachen will, »ein junges modernes Mädchen.«. Zumindest nicht modern im Sinne der Siebziger oder Achtziger. Das Buch ist nämlich im Original schon 1944 erschienen. Aber das fröhliche Goldene Schneider-Buch verrät uns davon natürlich nichts. Ein Kapitel mit Bezug auf den zweiten Weltkrieg wurde aus der deutschen Ausgabe geschickt herausgekürzt. Steffi muss ja modern bleiben. Und ich wette, im Original heißt Steffi auch gar nicht Steffi.
Aber nun zum vorliegenden Buch. Man kann nur rezensieren, was man gelesen hat, und da ich des Norwegischen nicht mächtig bin, bleibt es also bei der deutschen Fassung (in der übrigens noch ein weiteres Kapitel fehlt, nur so am Rande). Es erzählt die Geschichte einer jungen Frau, die – sehr modern im Vorkriegsnorwegen – als Übersetzerin auf eigenen Beinen steht und die Tochter eines Bekannten nach dessen Tuberkulosetod aufnimmt. Ihrem gutbetuchten Freund Carl ist nicht nur ihre Berufstätigkeit ein Dorn im Auge – schließlich soll sie als zukünftige Frau an seiner Seite vor allem repräsentieren – sondern auch das aufgeweckte Kind, und er regt an, es doch lieber zur leiblichen Oma zu geben. Hin- und hergerissen zwischen ihre Liebe zu Lisbeth und Carl, entscheidet Steffi sich erst für den Verlobten, aber als das Kind daraufhin, ungeliebt, vernachlässigt und nass geregnet, schwer erkrankt, gibt Steffi dem herzlosen Carl endlich den Laufpass, sucht sich einen besseren Mann, macht ihr Abitur und adoptiert Lisbeth.
Ich, die ich zuerst ein Buch zum Thema »Muttersein ist die wahre Bestimmung der Frau« erwartet hatte, wurde durch dieses wenig süßliche Buch angenehm überrascht. Zum einen wird klargestellt, wie wichtig Bildung und Beruf auch für Frauen sind (1944, wohlgemerkt!), zum anderen bringt das (Adoptiv-)Muttersein nicht nur Freuden mit sich, das blitzgescheite Kind kann auch nerven und quengeln, und Steffi, unerfahren und eigentlich zu jung für eine siebenjährige Tochter, verwandelt sich auch nicht über Nacht in eine Supermama. Natürlich wird sie das, am Ende, mit dem richtigen Superpapa an ihrer Seite, und eine Fortsetzung mit dem öden Namen Ein Mädchen von Siebzehn Jahren – die Titelpolitik deutscher Verlage hat sich während der letzten Jahrzehnte doch geändert, wie auch der lockere Umgang mit Autorennamen – erzählt dann von Lisbeths Jugend und ihren ersten Romanzen. Das habe ich aber nicht gelesen, und werde es wohl auch erst einmal nicht tun. Obwohl ich auch dieses Buch einarbeiten durfte. Der dritte Band dagegen, Lykkelige Lisbeth, scheint nie auf Deutsch erschienen zu sein.
Ein herausragend gutes Buch ist Meine Tochter Liz dennoch nicht. Vieles bleibt unklar oder arg oberflächlich, so etwas wie ein Jugendamt scheint man in Norwegen offenbar nicht zu kennen, denn es gibt keinen Behördenaufwand, als diese junge Frau das Kind eines eigentlich nur flüchtigen Bekannten einfach behält, aber das Buch ist für jugendliche Leserinnen geschrieben, die man nicht mit unnötigen Adoptions- und Organisationsdetails langweilen will. Der Stil ist locker, aber sehr einfach – das mag Schuld der Übersetzung sein, wer ein Buch um zwei Kapitel kürzt, ist auch mit der Sprache nicht zimperlich.
Für heutige Vierzehnjährige ist dieses Buch gänzlich unattraktiv. Aber wer sich mit Jugend- und besonders Mädchenliteratur ernsthaft befasst, kommt um Berte Bratt wohl nicht herum. Und da dieses ihre erstes auf Deutsch erschienenes Buch ist (erstmalig 1950 beim Schneider Verlag, und da wundert man sich dann auch nicht mehr über den herausgeschnittenen Krieg, denn Mädchenbücher sollten unterhalten und nicht belasten), tut gut daran, als exemplarisches Beispiel gerade Meine Tochter Liz zu lesen. Zwar ist von ursprünglich fünfzig Büchern auf dem deutschen Markt ist heute nur noch eines lieferbar, Gewagt – Gewonnen, Restauflage von 1995. Aber ich wette, jede gutsortierte Stadtbücherei hat immer noch ein oder zwei Regalbretter voll Berte Bratt. Und wenn nicht, hilft auch ein Blick in die Wühlkiste.



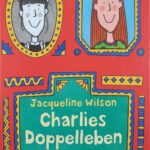

Kommentare