Den Luxus, ein wirklich schlechtes Buch zu lesen, hatte ich lange nicht mehr, aber diesem hier gebührt die Ehre. An so schlechte Bücher kommt man nur über die Bücherei – ich hätte es mir nie gekauft, und auch keiner meiner Freunde. Aber wenn es mir in der Bücherei in die Finger fällt, dann kann ich es mir unbesorgt ausleihen, ich muss es ohnehin zurückgeben, qualitätsunabhängig. Das Einzige, worüber man sich hinterher vielleicht ärgern muss, ist verschwendete Zeit. Das Gemini-Projekt ist da so auf der Grenze – zwischen »So schlecht, dass man es nicht lesen mag« und »So schlecht, dass es fast schon wieder Spaß macht«. Die Lektüre ist über weite Teile Quälerei, inhaltlich zum einen sowieso, sprachlich durch die Übersetzung unterster Kajüte noch dazu. Aber für Leute, die nur glücklich sind, wenn sie sich über etwas aufregen können, ist dieses Buch sicher etwas, vor allem für die Fünfzehnjährigen dieser Gruppe, die noch zu jung sind für die Bücher von Anne Rice.
Der Anfang des Buches ist bezeichnend für den vorherrschenden Mangel an Logik. Der schwerreiche EDV-Mensch verlässt die gepanzerte Limousine, schreitet durch die kameraüberwachte Lobby, ruft per Fingerabdruck den Hochsicherheitsaufzug und lässt sich so hermetisch abgesichert in seine Geschäftsräume katapultieren – wo er freundlich die Sekretärin begrüßt. Und der mitdenkende Leser fragt sich: Wie ist sie da hochgekommen? Entweder die Angestellten leben als Sklaven in den oberen Etagen des Wolkenkratzers und dürfen niemals ihre Ebene verlassen – oder es gibt eben doch eine Treppe oder einen zweiten Aufzug für Normalsterbliche. Womit dann der abgeschottete Hochsicherheitsaufzug gar keinen Sinn mehr macht. Mithilfe dieses Aufzugs kommt der reiche Mann dann auch prompt ums Leben, und spätestens da hätte ich mit der Lektüre aufhören sollen.
Aber ich hatte in den vergangenen Jahren zu viele Bücher beiseitegelegt und war nun gewillt, alles bis zum bitteren Ende zu lesen, egal wie bitter. Und so komme ich nicht um den jugendlichen Helden herum, Alex Rider. Der ist ein vierzehnjähriger Geheimagent für MI6. Natürlich. Was auch sonst. Er ist natürlich nur im Geheimen ein Geheimagent, offiziell ein ganz normaler Teenager, der natürlich nicht raucht und – anders als der Rest seiner ganzen Schule – keine Drogen nimmt, sondern lieber den bösen Dealer auffliegen lässt, nicht, indem er die direkt neben dem Drogenboot gelegene Polizeiwache aufsucht, sondern indem er einen riesigen Baukran kapert, um das Boot aus dem Wasser zu heben und direkt auf dem Polizeiparkplatz abzusetzen. Natürlich. Was auch sonst. Wir haben unseren Lesern doch Action versprochen!
Und ähnlich sinnlos, konstruiert und unmotiviert sind alle anderen Actionsequenzen des Gemini-Projekts. Zunehmend denke ich an die Handlungen von Rollenspielfiguren, deren Spieler es immer wieder schaffen, die naheliegendsten Lösungen zu ignorieren oder zu übersehen, weil sie nach einer Gelegenheit gieren, ihre mächtigen Zauber oder ihre Hightechausrüstung einzusetzen, die sie sonst nie brauchen würden. Wobei wahrscheinlich jeder Spielleiter seinen Spielern das Konzept »unbescholtener Jugendlicher erbt Geheimdienststellung vom verstorbenen Onkel« im Vorfeld um die Ohren gehauen und nicht zugelassen hätte. So, wie es auch jeder mitdenkende Lektor mit dem angeblich preisgekrönten Mr Horowitz hätte tun müssen. Aber tatsächlich ist das Gemini-Projekt schon der zweite Band um die Abenteuer des streng geheimen Alex. Ich sehe keine Veranlassung, auch noch den ersten Band zu lesen.
Alex wird undercover in ein Eliteinternat eingeschleust, das sich laut Klappentext in den Schweizer Alpen befindet, tatsächlich aber im französischen Grenoble liegt. Dort soll er – was auch sonst – seltsame Entwicklungen untersuchen und herausfinden, warum sich die angeblich schwersterziehbaren Söhne (einfluss)-reicher Familien plötzlich, statt zu wertvollen Gesellschaftsmitgliedern geschliffen zu werden, wie gesichtslose Zombies aufführen. Und natürlich, warum einige der (einfluss)-reichen Väter unter merkwürdigen Umständen das Zeitliche gesegnet haben – der manipulierte Aufzug, wir erinnern uns.
Dabei stellt sich Alex, trotz faszinierendster Ausrüstung – darunter ein schießendes Harry-Potter-Buch und ein Discman, der sich zur Kreissäge umfunktionieren lässt – erwartungsgemäß plump und dämlich an, lässt sich mit KO-Tropfen außer Gefecht setzen, bevor es überhaupt losgegangen ist, dass man fast schon den Schurken den Sieg wünschen würde.
Um dies zu verhindern, lässt der Autor alle Bösen auch wirklich plakativ böse auftreten – sie sind alle verkappte Nazis und trauern der südafrikanischen Apartheit nach. Der schmierige Dealer mit den verfaulten Zahnstümpfen fährt Skoda, während die Reichen selbstverständlich Mercedes fahren – warum an Markenklischees geizen, wenn auch sonst keine ausgelassen werden? Und dennoch ist der einzige Lichtblick dieses Machwerks der Plan des Schurken, wie er nun die Weltherrschaft übernehmen will: Das hat Pep und Witz und macht fast Sinn und kommt dem sehr nahe, was die schurkischen Gegenspieler konventioneller Superhelden (in Film, Comic, Zeichentrick oder Rollenspiel) sonst schon mal vorhaben. Nur für ein Buch ist es nicht wirklich geeignet. Horowitz hätte sich vielleicht fragen sollen, warum es so wenig Superheldenromane gibt. Nicht, weil noch niemand vor ihm auf die Idee gekommen ist – sondern weil einfach nichts Gutes dabei rumkommt.
Das dramatische Showdown in den französischen Schweizer Alpen erreicht dann auch in seiner Bodenlosigkeit den Kampf auf der Seilbahn in Agenten sterben einsam, und der Versuch des Autors, ein spannungsgeladenes offenes Ende zu produzieren, hinterlässt beim Leser die Hoffnung, dass vielleicht Alex doch tot ist und durch einen Klon ersetzt werden konnte – doch ich werde mir keine Fortsetzung antun, um das herauszufinden.
Berührt hat mir an diesem Buch eine einzige Szene, in der man Alex erklärt, dass die Jungen in der Anstalt nicht mit ihren Eltern telefonieren dürfen, damit sie kein Heimweh bekommen. Ach, das klingt nach traurigen Erfahrungen. Der einzig realistische Moment der Geschichte. Vielleicht war auch Horowitz als Kind einmal zur Kur. Vielleicht saß er auch auf seinem Zimmer und heulte sich die Augen aus, weil die Eltern nicht mal am zehnten Geburtstag angerufen hatten – während derweil die Eltern wutschnaubend von der Heimleiterin hören mussten, warum man sich weigerte, das Kind ans Telefon zu lassen…
Aber wie diese traurige Anekdote aus meiner Kindheit ist Das Gemini-Projekt (Englischer Originaltitel: Point Blanc) eine Erfahrung, auf die ich lieber verzichtet hätte. Und so kann ich jedem nur allerwärmstens von der Lektüre dieses Buches abraten.

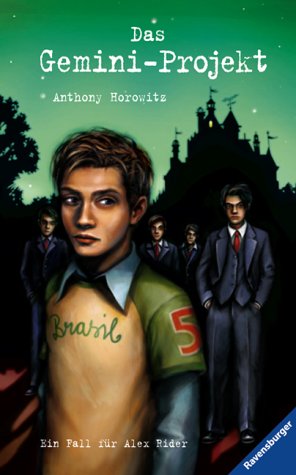




Kommentare