Es ist lang her, dass ich meine letzte Rezension veröffentlicht habe – mehr als zwölf Jahre. Ebenfalls lang, wenn auch nicht ganz so lang, ist es her, dass ich das letzte Buch gelesen habe. Das hängt zusammen: Ohne die Aussicht, eine Rezension schreiben zu dürfen, fehlte mir meistens die Motivation, bei einem Buch, das mich nicht zu hundert Prozent in seinen Bann schlägt, bis zum Ende durchzuhalten. Aber ich dachte, als veröffentlichte Autorin – und das bin ich in der Zwischenzeit geworden – dürfte ich nicht mehr rezensieren. Mumpitz. Natürlich darf ich. Nicht hinterrücks und anonym die eigenen Kollegen schlechtmachen. Aber transparent und begründet loben und kritisieren. Und so bin ich wieder zurück mit Bibliophilis, nach nur zwölf Jahren Pause.
Was ich in den letzten Jahren unverändert getan habe, ist, Bücher zu kaufen. Schöne, interessante Bücher reizen mich wie eh und je, auch wenn ich kaum eines davon angefasst habe, nachdem es einmal im Regal stand. Seit dem letzten Februar bin ich Abonnent der Locked Library, einer britischen Überraschungs-Bücherbox, die mir jeden Monat ein schmuckes Buch liefert, komplett mit Farbschnitt, verziertem Einband und eingedrucktem Brief der Autor:innen. Ein Jahr lang habe ich diese Bücher bewundert, angegrabbelt, und in einem Stapel neben meinem Bett gesammelt – vieles davon hat mich auch von Klappentext her sehr angesprochen, aber gelesen habe ich keines von ihnen. Bis jetzt. Neues Jahr, neues Leben, neue gute Vorsätze.
Und auch wenn ich so neugierig auf das Buch war, das ich mir zum Wiedereinstieg ins Leserleben ausgesucht hatte, dass ich am liebsten noch im alten Jahr mit der Lektüre angefangen hätte, habe ich gewartet bis zum ersten Januar, ehe ich mich darüber hergemacht habe. Jeden Tag mindestens fünfzig Seiten, das ist mein Plan fürs neue Lesejahr. Und so habe ich auch gelesen, in fünfzig-Seiten-Schritten. Es ist mir oft schwergefallen – ich lese nicht mehr so schnell wie früher, kann mich nicht mehr so gut konzentrieren, nicht gut bei einer Sache bleiben. Aber ich habe mich durchgebissen.
The Gilded Crown, das Debüt der schottischen Autorin Marianne Gordan, hat mich nicht so gepackt, dass ich es nicht mehr aus der Hand hätte legen mögen, und so ist es beim inkrementellen Lesen geblieben. Aber es hat mich bewegt. Ich wollte, dass das Lesen mich wieder bewegen sollte. Aber nicht unbedingt so. Dieses Buch hat mich nicht glücklich gemacht, sondern traurig und zornig, und als ich es durch hatte, habe ich mich nicht gut gefühlt oder erfüllt, sondern seltsam leer. Ein Buch, das so etwas kann, ist kein schlechtes Buch. Es war nur vielleicht nicht das richtige Buch, um nach so einer langen Pause wieder ins Lesen einzusteigen.
Der Klappentext hat mir vieles versprochen, das mich gereizt hat: eine junge Frau, welche die Toten wiederbeleben kann, für einen Preis – eine Prinzessin, die zum Opfer intriganter Attentäter wird – und eine Liebesgeschichte zwischcen den beiden. Und wo ich normalerweise nicht entsetzlich wild auf Romanzen bin, habe ich doch eine Schwäche für queere Liebesgeschichten, und da freue ich mich, wie divers der Buchmarkt in den letzten Jahren doch geworden ist. Doch hier verrät der Klappentext zu viel, und vor allem das falsche. Ich hatte mich auf eine schöne Liebesgeschichte gefreut – und dann bis zur letzten Seite gehofft, dass sie sich nicht kriegen. Denn die Beziehung, um die es in diesem Buch geht, ist keine gesunde.
Hellevir belebt die Toten wieder, seit sie ein kleines Mädchen ist. Den Preis dafür bezahlt sie mit Teilen ihrer Selbst – Stücke ihrer Seele, Blut, hier ein Finger, da ein bisschen mehr. Als sie ihre im Kindbett verstorbene Mutter wiederbelebt, nicht jedoch das totgeborene Kind – mehr als eine Wiederbelebung auf einmal geht nicht – treibt das einen Keil zwischen Mutter und Tochter, und dieses gespaltene Verhältnis zieht sich von da an durch das gesamte Buch. Die Familie – Vater, Mutter, großer Bruder – zieht ohne Hellevir in die Hauptsadt, das Mädchen bleibt in der Obhut der Heilerin zurück, die selbst auch schon mal jemanden wiederbelebt hat, lernt von ihr das Handwerk der Kräuterkundigen, und muss sich, nachdem sie die tote Kronprinzessin wiederbelebt hat, fragen lassen, warum sie das nicht für jeden tut, warum andere für immer sterben müssen, wenn Hellevir doch die Macht hat, jeden zu retten.
Aber mit einer Wiederbelebung ist es nicht getan, Hellevir wird an den Hof berufen, um sich jederzeit auf Abgruf zu halten, sollte Prinzessin Sullivain nochmal etwas zustoßen, und der Attentäter ist immer noch auf freiem Fuß … Und ab da schleppte sich das Buch dann doch deutlich. Sensationsgeil wünschte ich mir, die Prinzessin würde deutlich öfter sterben, wie es mir der Klappentext doch versprochen hatte – vor allem aber hoffte ich, Hellevir würde endlich mal ihre Gaben gewinnbringend einsetzen.
Denn die kann deutlich mehr, als nur ins Totenreich marschieren und mit einer Seele wieder rauskommen. Sie ist außerdem in der Lage, mit Tieren und den Geistern der Natur zu sprechen – ob Weidebaum, Fluss oder Herdfeuer, Hellevir kann sich damit unterhalten: Warum sitzt sie dann völlig deplatziert auf dem Ball eines der noblen Häuser der Stadt und versucht, adlige Konversationen abzuhören auf der Suche nach Prinzessin Sullivains Mörder, statt die Küchenkatze zu befragen, die Brieftauben, oder was sonst so kreucht und fleucht?
An der Stelle gebe ich die Schuld der Autorin, die vieles einfach nicht zu Ende gedacht hat. Hellevir wäre nicht nur die geborene Geheimagentin – sie wäre auch, wäre ich der intrigante Attentäter, das Ziel meines nächsten Anschlags, noch bevor ich mein Glück nochmal bei der Prinzessin versuche: Denn auch wenn nicht genau bekannt ist, wie diese Kräuterfrau das Leben der Prinzessin gerettet hat, fest steht, dass sie es hat, und da würde ich, so als gewiefter Mörder, kein Risko eingehen.
Naütrlich bringt Hellevir trotzdem heraus, wer hinter den Anschlägen steckt, und natürlich ist es die einzige Person, die dafür, dramaturgisch gesehen, infrage kam: Auch nach zwölf Jahre Lesepause habe ich nicht meine Gabe verloren, Mörder bei ihrem ersten Auftreten korrekt zu identifizieren. Und natürlich ist es die Person, deren Enttarnung Hellevir und ihrer Familie das größtmögliche Unbill bereiten kann. Damit nimmt das Buch wieder an Fahrt auf, aber für die Romanze zwischen Hellevir und Sullivain ist es da für mich zu spät, zu viel hat sich die Prinzessin geleistet, das ich ihr nicht verzeihen kann, und so wünsche ich mir, Hellevir möge eine nette junge Frau kennenlernen und an deren Seite ihr Glück finden, statt ihre Seele mehr und mehr mit dem Objekt ihrer Wiederbelebungsversuche zu verknüpfen.
Aber in der Hauptstadt gibt es nicht nur höfische Intrigen, es geht auch um Religion: Immer mehr gewinnen die monotheistischen Onaistians an Einfluss, verdrängen die Alten Wege, denen Hellevir folgt – und der Spalt zieht sich quer durch Hellevir und ihre wiedervereinte Familie, denn ihre aus dem Ausland stammende Mutter ist eine bekennende Onaistian, der Vater hingegen hängt wie der Rest der Familie den alten Göttern an. Dass die Onaistians nicht so nett sind, wie sie tun, versteht sich von selbst, und Wiederbelebungen sind für sie gegen die göttliche Ordnung. Selbst wenn sie die Prinzressin betreffen …
Vieles an diesem Buch hat mir gefallen. Wie selbstverständliche gleichgeschlechtliche Liebesbeziehungen in der Welt von Chron sind, nicht stigmatisiert werden, sondern ganz offen ausgelebt werden können, zeigt sich vor allem an der Liebesgeschichte von Hellevirs Bruder Farvor und Calgir, zwei Figuren, die mir deutlich mehr ans Herz gewachsen sind als Hellevir und Sullivain und die eine gesunde Beziehung auf Augenhöhe pflegen, was ich von einem Ritter und seinem Squire schon aus Standesgründen nicht erwartet hätte.
Ich mochte auch die durchaus differenzierte Zeichnung der Figuren, und schön geschrieben ist das Buch auch, selbst wenn man über die wenig eingänglichen Namen doch oft stolpern muss – wie die Haupstadt Rochidain nun ausgesprochen werden soll, darüber habe ich mir bis Ende der Lektüre keine feste Meinung bilden können. Schön sind auch die Rätsel, mit denen Hellevirs jenseitiger Geschäftspartner sie, so als kleine Schnitzeljagd nebenbei, nach Schätzen suchen lässt, mit denen sie Seelen freikaufen kann, ohne noch mehr Körperteile zu opfern: Davon hätte es für mich gern noch mehr geben können.
An anderen Stellen zeigt sich Gordons Unerfahrenheit: Wenn sich nach zwei Dritteln des ansonsten konsequent aus Hellevirs Perspektive erzählten Buches ebenso abrupt wie unnötig für viereinhalb Seiten in eine andere Perspektive wechselt – die danach noch zweimal, vergleichbar kurz, in Erscheinung treten darf, reißt das aus dem Lesefluss und hat mich so sehr gestört, dass ich erst mal gar nicht mehr weiterlesen wollte. Da hätten ihre erfahrenen Lektorinnen einschreiten müssen und die Debütantin ermutigen, diese überflüssigen Szenen rauszukürzen: Hellevir kann nicht überall sein, nicht alles wissen, und das ist völlig in Ordnung und darf auch für die Leser:innen so gelten.
Und dann über allem die Angst, aus der Beziehung zwischen Hellevir und Sullivain könnte etwas werden, das man mir als die große Liebe verkaufen will! Denn von Sullivains Verhalten mal abgesehen, ist das Machtgefälle zwischen beiden Frauen zu groß, und das auf beiden Seiten: Sullivain hat zu viel Macht im Leben und bindet Hellevir mit Drohungen und Erpressung an sich; Hellevir hat im Jenseits die Macht über Sullivains Leben und Tod – daraus kann keine gesunde Beziehung wachsen!
Dazu nimmt Hellvir zu vieles klaglos hin. Nicht nur da, wo sie gezwungen wird, sondern auch da, wo sie einschreiten müsste, Fragen stellen: Wie hat es ihre Mutter überhaupt ins Ausland verschlagen, an die Seite eines Heiden in einem Dorf irgendwo im Nirgendwo? Was hat es mit dem Halsanhänger von Hellevirs Großmutter an sich, der die Macht hat, eine ganze Legion wiederzubeleben? Sie rätselt zwar laufend über die Identität ihre Unterweltkontakts, aber ansonsten verkneift sie sich jede Frage, auch die, die sie wirklich sehr dringend stellen müsste. Sympathischer macht sie das nicht.
Am Ende hat mich das Buch ratlos zurückgelassen. Der Schluss hat mich ein wenig mit dem Rest versöhnt, aber ob ich die – noch nicht angekündigte – Fortsetzung lesen möchte, das weiß ich noch nicht. Dieses Buch hat mir wehgetan, mehr, als mir lieb war. Gern würde ich einfach darüber amüsieren, dass Gordon offenbar vergessen hat, wie groß so ein Rabe doch ist, wenn Hellevirs Vertrautentier Elesvir auf ihrer Schulter reitet, oder darüber, dass die Autorin, Mitarbeiterin eines Wissenschaftsverlags, diesen Raben sehr offensichtlich nach dem bekannten Elsevier-Verlag benannt hat oder die Peers-genannten Priester nach jenen Menschen, die über Erfolg oder Scheitern eines wissenschaftlichen Texts entscheiden – aber ich bin zu aufgewühlt. Wie Hellevir fühle ich mich, als hätte ich Stücke meine Seele in diesem Buch zurückgelassen, und das ist kein gutes Gefühl.
Ich bin der Locked Library dankbar, dass sie mir dieses Buch hat zukommen lassen – der nichtssagende Titel und das ebenso langweilige Cover hätten mich nie dazu bewegt, auch nur den Klappentext zu lesen, und der Reihentitel, The Raven’s Trade, ist nur unwesentlich besser. So aber habe ich ein Buch gelesen, das mich wirklich bewegt hat, nur nicht so, wie ich gerne bewegt worden wäre. So empfehle ich das Buch auch gerne weiter, aber nicht an Leute, die sich auf eine romantische Liebesgeschichte zwischen zwei Frauen lesen wollen – denn die ist hier nicht romantisch, sondern nur beklemmend. Wer sich hingegen auf ein Buch einlassen mag, das unbequem ist, das wehtut und aufwühlt, ist hier richtig.

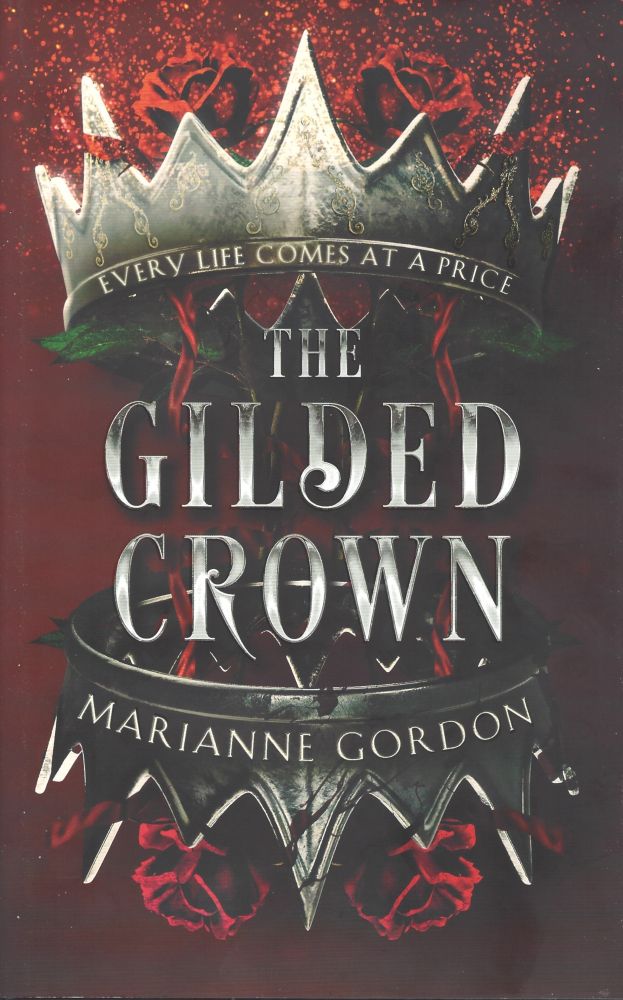



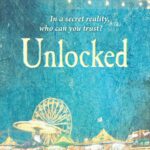
Kommentare